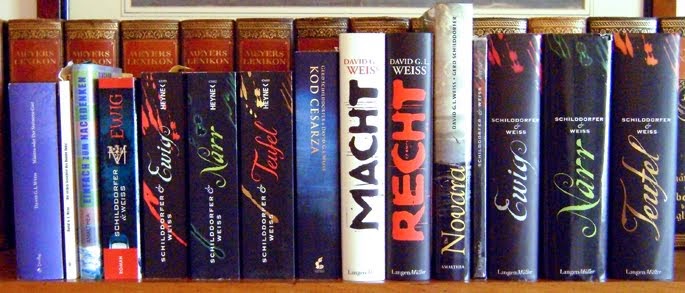2. Ein- und Überleben im Land der unbegrenzten Widersprüche
 Viele kennen, denke ich, den Fahrenden Ritter (engl.: Knight
Bus) aus den Harry Potter-Büchern.
Den wie ein herrenloser Ritter herumvagabundierenden violetten Bus, den nur Hexen
und Zauberer im Notfall rufen und benutzen. In den Büchern fährt der exklusive Bus
chaotisch kreuz und quer, springt wie das im Original namensgebende Rössel im Schach querfeldein (> engl.:
Knight). Der Fahrende Ritter ist im Harry Potter-Universum
ein Teil der magischen Welt, für normale Sterbliche bleibt er unsichtbar. Seine
Entsprechung in der Wirklichkeit hat das fiktive magische Verkehrsmittel im Yale Shuttle. Auf jeden Fall fühlt es
sich für Neuankömmlinge so an. Die Busse sind natürlich nicht unsichtbar,
mitfahren darf aber nur, wer einen Ausweis der Yale Universität hat. Gehört man
dazu, dann ist das dichte und regelmäßige Verkehrsnetz aus mehreren Linien gratis.
Um zu wissen, wo die Busse halten und wann sie fahren, braucht man keinen
Zauberstab in die Höhe zu halten, aber eine entsprechende App auf dem
Smartphone. Die Haltestellen sind auf der Straße gar nicht, oder nur selten
markiert. Gelegentlich verrät eine größere Menschenansammlung, wo die Shuttles
halten werden. Eine bunte Gruppe, die sich, die Augen fest auf die Smartphones
in den Händen geheftet, nicht miteinander unterhält. Das Yale Shuttle zu benutzen ist eine Kunst, die Übung braucht. Hat man
erst den Bogen raus, ist es eine feine Sache. Davor, das heißt vor dem Download
und dem Verstehen der App, kommt es vor, dass die Busse trotz Winkens an einem
vorbeifahren, weil z.B. nicht mehr der Nachmittags-, sondern bereits der
Abendfahrplan gilt, mit unterschiedlichen Haltestellen. Dann gelten auch andere
Routen, das heißt man entdeckt neue Viertel und Regionen, Orte, wo man gar
nicht hin wollte. Auch schön und informativ, aber leider falsch. Ebenfalls sehr
beliebt, man wartet auf den Bus in der Gegenrichtung, was bei einem Rundkurs
nur in eine Fahrtrichtung etwas länger dauert. Da kommt Godot eher als der
Shuttlebus. Aber hat man diese anfänglichen Hürden erst genommen, steht New
Haven dem staunenden Gast offen.
Viele kennen, denke ich, den Fahrenden Ritter (engl.: Knight
Bus) aus den Harry Potter-Büchern.
Den wie ein herrenloser Ritter herumvagabundierenden violetten Bus, den nur Hexen
und Zauberer im Notfall rufen und benutzen. In den Büchern fährt der exklusive Bus
chaotisch kreuz und quer, springt wie das im Original namensgebende Rössel im Schach querfeldein (> engl.:
Knight). Der Fahrende Ritter ist im Harry Potter-Universum
ein Teil der magischen Welt, für normale Sterbliche bleibt er unsichtbar. Seine
Entsprechung in der Wirklichkeit hat das fiktive magische Verkehrsmittel im Yale Shuttle. Auf jeden Fall fühlt es
sich für Neuankömmlinge so an. Die Busse sind natürlich nicht unsichtbar,
mitfahren darf aber nur, wer einen Ausweis der Yale Universität hat. Gehört man
dazu, dann ist das dichte und regelmäßige Verkehrsnetz aus mehreren Linien gratis.
Um zu wissen, wo die Busse halten und wann sie fahren, braucht man keinen
Zauberstab in die Höhe zu halten, aber eine entsprechende App auf dem
Smartphone. Die Haltestellen sind auf der Straße gar nicht, oder nur selten
markiert. Gelegentlich verrät eine größere Menschenansammlung, wo die Shuttles
halten werden. Eine bunte Gruppe, die sich, die Augen fest auf die Smartphones
in den Händen geheftet, nicht miteinander unterhält. Das Yale Shuttle zu benutzen ist eine Kunst, die Übung braucht. Hat man
erst den Bogen raus, ist es eine feine Sache. Davor, das heißt vor dem Download
und dem Verstehen der App, kommt es vor, dass die Busse trotz Winkens an einem
vorbeifahren, weil z.B. nicht mehr der Nachmittags-, sondern bereits der
Abendfahrplan gilt, mit unterschiedlichen Haltestellen. Dann gelten auch andere
Routen, das heißt man entdeckt neue Viertel und Regionen, Orte, wo man gar
nicht hin wollte. Auch schön und informativ, aber leider falsch. Ebenfalls sehr
beliebt, man wartet auf den Bus in der Gegenrichtung, was bei einem Rundkurs
nur in eine Fahrtrichtung etwas länger dauert. Da kommt Godot eher als der
Shuttlebus. Aber hat man diese anfänglichen Hürden erst genommen, steht New
Haven dem staunenden Gast offen.
Mein erster Eindruck von New Haven war ein farbenfroher. Das
lag nicht alleine an den Linien des Yale
Shuttles: Yellow, Orange, Red, Purple, Blue und Green. Das Straßenbild war bunt. Jede und jeder von denen, die hier
studierten oder lebten, kam von irgendwoher anders. Es hat mich bewegt in einer
Diskussionsveranstaltung zu hören, dass die Stadt, im Vergleich zu New York
oder Brooklyn, als sehr segregated,
als getrennt, wahrgenommen wird. Ich
war nicht blind, mir war aufgefallen, dass alle Bus- und Taxifahrer, beinahe
jeder Kellner und die Mehrheit der Hausbesorger, Straßenkehrer und
Kassiererinnen Afroamerikaner oder Hispanisch waren. Die Gärtner, die das
Grundstück, auf dem wir wohnen, frühlingssauber machten, waren auch Farbige. Genau
wie die übrigen in unserer Wohngegend. Juliane hat auch bemerkt, dass es in den
Filialen derselben Kette in unterschiedlichen Stadteilen verschiedene Waren zu
kaufen gibt. Gab es in Universitätsnähe dieselben Pflegeprodukte in der Drogerie
wie daheim, standen ein paar Querstraßen weiter Zahnpasta und Mundwasser mit
Schmerzmittel in den Regalen. Spazierten wir an den mächtigen
Universitätsgebäuden vorbei und an ihren Satelliten, d.h. an den Apartmenthäusern,
Lokalen, Boutiquen und Läden, begegneten wir Obdachlosen, die uns um Kleingeld
baten. Auf dem Weg zur chinesischen Reinigung kamen wir an einem Hotel vorbei,
dessen Gäste so elegant und sehenswert waren, dass die Fassade des Restaurants
und die Fenster der Gästezimmer als Schaufenster gestaltet waren. Und in
derselben Gasse, nur ein Haus weiter, an einem zerlumpten Penner, der sich
Würmer aus dem Fuß zog.
Als Europäer sahen wir die ökonomischen Gründe, z.B. den
getrennten Zugang zu Einkommen, Bildung und Gesundheitswesen. Ich fand (und
finde) es unappetitlich von Rasse zu
sprechen. Ich bin weder Hund noch Pferd. Und obwohl ich eben kein Pelztier bin,
ging – und geht – es mir gegen den Strich, seit meiner Einreise in Dokumenten meine
Rasse anzugeben. Caucasian? Come on! Weder meine persönliche, noch meine familiäre
Geschichte hat etwas mit dem Kaukasus-Gebirge zu tun. Ich bin auch kein blasser
Hartkäse eines Hirtennomaden. Ich kannte ihn bisher nur aus den düsteren
Kapiteln der Geschichte, hier gehört der Begriff Rasse für mich zum Alltag. Über eine Heritage Community, ein gemeinschaftliches geschichtliches Erbe,
verfüge ich nur, wenn meine Familie auf Ausgrenzung und Ausbeutung
zurückblickt. Aber dann bin ich in der Minderheit. Erst absolutes kulturelles
Vergessen lässt mich zur Mehrheit gehören. Und „wir Weißen“ waren einmal so
herablassend, Außereuropäer und Autochthone als „geschichtslose Wilde“ zu
beschreiben.
Bei meiner Ankunft in New Haven war ich tagelang körperlich
völlig fertig. Ich hatte das Gefühl, mein Tank mit Lebensenergie hatte irgendwo
ein Loch. Und während es aus dem Leck rieselte, versuchte Juliane hartnäckig
meine Therapie bzw. die Fortsetzung meiner Behandlung zu organisieren. Dank der
zupackenden Hilfe ihres Gastgebers vom German
Department war ich so ziemlich der erste Patient, der bereits zwei Tage
nachdem die Ärzte im New Haven Hospital überhaupt
von ihm gehört hatten, schon im Behandlungszimmer saß. Was dieser Professor für
mich getan hat, grenzt an Telefonterror. Ich hatte schon drei Mal Photopherese
hinter mir, als der Überweisungsbrief in Englisch aus Wien eintraf.
Nach all diesen ersten Eindrücken von unserem (Über-)Leben
in den USA muss ich es leider offen schreiben, selbst wenn ich dabei wie
Urstrumpftante Aloisia rüberkomme, wir haben uns in Europa zu sehr daran
gewöhnt, Vieles für selbstverständlich oder als Anspruch zu verstehen, was
außerordentlich, hart erkämpft und großartig ist. Und ich gelobe jedes Mal,
wenn ich mich mit Julianes Hilfe über die Stufen in ein Yale Shuttle hieve, jeder und jedem gegen das Schienbein zu treten,
die ich noch einmal über die Wiener
Linien raunzen höre, wo ich bequem alle drei bis sechs Minuten in einen
fabrikneuen Niederflurbus einsteigen kann. Einmal auf dem Weg ins Krankenhaus
sind wir in einem Busveteranen gesessen, der Laute aus dem Getriebe von sich
gab, dass wir glaubten, er würde an Ort und Stelle liegen bleiben. Ich begegnete
hier Menschen im Job und bei der Arbeit in einem gesegneten Alter, in dem
gewisse Leute bei uns im Park sitzen und über die faule Jugend lästern. Hier
kostet einfach alles Geld, und das muss jede und jeder alleine verdienen. Ohne Hilfe
oder Unterstützung. Das ist nicht erstrebenswert und toll, und es ist auf
keinen Fall gerecht.
Demokratie war und ist dieser Tage ein großes Thema. Dem
alten Rom sehr ähnlich, droht die Diktatur die Republik abzulösen, die
Loyalität zu einer einzelnen Person das allgemeine Recht abzuschaffen. Nicht
nur in den USA. Und besonders bitter, für viele Menschen in der Gesellschaft
hat sich in zweihundert Jahren rein äußerlich nichts geändert, außer dass sie
jetzt für ihre Arbeitsleistung Steuern zahlen müssen. Und während ich als Gast im
Yale Shuttle an den Kathedralen des
Wissens im Tudorstil und den vollgepackten Einkaufswägen der Sandler und Penner
vorbeifahre, frage ich mich, wann eine gemeinsame Entscheidungsbasis für die Demokratie
geschaffen wird? Nämlich, Gesundheit und Bildung für alle.
Und trotz allem habe ich das Gefühl, schon jahrelang in New
Haven zu leben. Alles sieht so vertraut aus. Die Architektur, die Holzhäuser
und das Straßenbild. Sogar die Melodie des Eiswagens, der kurz darauf langsam
vorbeifährt. Woher nur, fragte ich mich, kannte ich das alles? Und die Antwort
war so einfach wie auch irgendwie erschreckend: Aus dem Fernsehen und aus Kinofilmen!
Diese Welt ist mir aus der Freizeitunterhaltung so sehr vertraut geworden, dass
ich versucht war zu glauben, längst ein Teil von ihr zu sein.
Fortsetzung folgt…