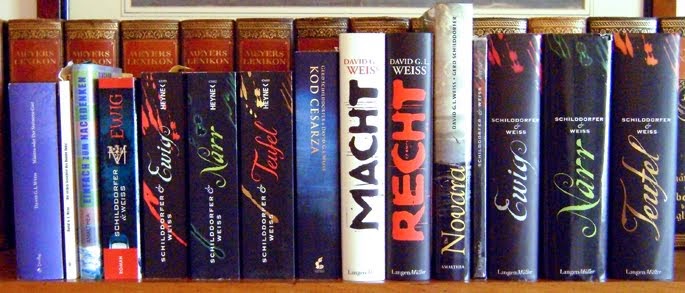5. Warten auf den Sommer – Vermischtes aus dem Land der
unbegrenzten Widersprüche
Es ist getan, ich habe meine
Sommergarderobe. Zwei Cargo Shorts, zwei Sonnenhüte zum Wechseln und alles. Was
mir jetzt noch fehlt, sind die sommerlichen Temperaturen. Die Quecksilbersäule
im Thermometer, tatsächlich ganz zeitgemäß das Handydisplay (in Celsius und in
Fahrenheit), lässt sich aber noch bitten. Und der Wetterbericht gelobt
Besserung zum Wochenende. Das gibt Hoffnung. Der Dauerregen, der die Natur
grünen und gedeihen lässt, bringt den menschlichen Humor zum Welken. Während draußen
also die Blätter sprießen, gehen mir derweil die Blüten aus. Wäre dazu nicht
längst alles notiert und wieder vergessen worden, ich käme auf den Gedanken,
dass menschliches Temperaturempfinden anerzogen ist. Ich habe nicht wie Charles
Darwin gebürtige Feuerländer als Informanten zur Verfügung, niemand hat das
mehr, aber die Nachbarskinder tollen in der Unterhose und barfuß im Garten. Ihre
Mütter stehen in der langärmligen Fleecejacke daneben, und zu meinen Füßen
knackt anheimelnd die Heizung. Auf dem Nummernschild der Eltern steht Florida: The Sunshine State. Naja, vielleicht
doch irgendwie genetisch? Dagegen sprechen die Joggerinnen und Läufer aus aller
Herren Länder, die bei steigenden Temperaturen und mehr Sonnenstunden demnächst
zu Lendenschnur und Peniskalebasse greifen.
Commencement ist endgültig vorbei. Das Feuerwerk war heuer
enttäuschend. Zwei Böller quälten sich durch den Niederschlag in die Luft und verpufften.
Das Pulver war nass. Immerhin hat es geknallt. Was zur Mitternacht folgte, war nicht
imstande mich zu wecken, so dass ich davon ausgehen durfte, nichts versäumt zu
haben. Juliane und ich sind dieser Tage im Yale
Shuttle aber zwei jungen Herren in pastellfarbenen Kleidern begegnet. Diese
beiden boten ein dem Anlass entsprechendes Spektakel: Die beiden Burschen, es
waren keine Jungs mehr und noch keine Männer, präsentierten sich und uns, den in
ihren Augen mitreisenden Claqueuren, den Bestellkatalog der Absolventenringe. Ihre
Darbietung imitierte perfekt die Vor- und Zurschaustellung von Reichtum, mit
der Will Smith als Fresh Prince von Bel
Air ein Millionenpublikum unterhalten hatte. Das war vor 27 Jahren (O Gott!). Entsprechend fesselte es
niemanden mehr im Bus. Im Gegenteil, die meisten waren peinlich berührt. Außerdem
war die Bühne falsch gewählt, wir alle hatten entweder einen Abschluss, oder
eine Yale-ID. Auch und vor allem der Busfahrer. Das war der Yale-Shuttlebus! Bitte,
es stand schon in der Bibel (einem noch viel älterem Blockbuster): Was soll dem Toren Geld in der Hand,
Weisheit zu kaufen, wo er doch ohne Verstand ist? (Sprüche 17,16)
Der Science March war eine tolle und vor allem laute Angelegenheit. Da
wurden Lieder gesungen und Parolen gerufen. Für die Weisheit, gegen den
Präsidenten und vor allem gegen die Dummheit. Wie anno dazumal. In allen keimte
die Hoffnung, und sie lebt noch immer, dass Donald Trumps erhobene zwei Daumen
demnächst zu einem gleichwertigen historischen Symbol werden wie Richard Nixons
erhobene zwei Zeigefinger. Wir marschierten eine Straße hoch/hinauf und die
nächste wieder runter. Die Stimmung war großartig. Wir zogen alle an einem
Strang. Alle bekannten sich zur Demokratie, zur Republik, zur Wissenschaft und
einem aufgeklärten Weltbild. Links und rechts der Straße winkten die Menschen
aus den Fenstern und Gärten. In dem Viertel wohnten nur Yalies. Die anderen
Gebäude gehörten der Uni. Auch an der Theologie am Ende der Route wehte die
Regenbogenfahne. Ein gutes Gefühl! Wir standen alle auf der moralisch richtigen
Seite. Wir bekräftigten uns gegenseitig so sehr, dass wir gar nicht merkten,
wie sehr das Bild, das wir boten, Schlagseite bekam, und das Schiff, das sich
Gesellschaft nannte, langsam kenterte.
Als ich nämlich am Eingang zum
Krankenhaus die kurze Treppe zum nächsten Aufzug hinaufmusste, der erste Lift
war kaputt, kamen mir erst eine Rettungsfahrerin und dann eine Frau entgegen.
Die Frau war entsetzlich dünn, sie sah aus wie ihre eigene Großmutter. Sie
fragte die Rettungsfahrerin, ob ihre Sozialarbeiterin wusste, dass sie
nachhause kommt. Das wusste wiederum die Gefragte nicht, und sie antwortete,
die Frau sollte die Sozialarbeiterin besser anrufen. Aber das ging nicht. Die
Frau hatte keine Minuten mehr auf dem Prepaid-Handy.
Ich will in keiner Gesellschaft
leben, in der es Zäune gibt. In der Bobos und Reverends vom Elend in Palästina
oder sonst wo predigen, während ihnen die Ungerechtigkeit vor der eigenen
Haustür völlig egal scheint. In der es Wohngegenden für die einen, und Ghettos
für die anderen gibt. Dazu muss ich kein Gutmensch sein. Auch von einem
Standpunkt, der geprägt ist von purer Egozentrik, möchte ich niemanden leiden
sehen. Der Anblick ruiniert mir den Tag. Und kommt dann auch noch Empathie hinzu,
Mitgefühl nicht Mitleid, dann wird es überhaupt unerträglich. Eine
Krankenschwester meinte zu mir, man müsse Leid am eigenen Leib erfahren haben,
um zu verstehen, was es bedeutet. Ich hoffe, das können wir billiger haben und
eher Abhilfe schaffen.
Um die Gegenwart zu verstehen,
soll man von und aus der Geschichte lernen. Vor allem um die alten Fehler in
Zukunft zu vermeiden. Yale ist ein hervorragender Ort dazu. Hier gibt es
fantastische Sammlungen und Museen. Zusammengetragen von Privaten und
Universitätsinstituten. Man darf sich also kein kaiserlich-königlich
gegründetes Kunsthistorisches oder Naturhistorisches Museum erwarten, man wird
trotzdem oder gerade darum begeistert sein. Für Yale-Bulldogs ist der Eintritt frei. Ich bekomme sogar einen
Rollstuhl gestellt. Auf dem kann ich durch die Säle rasen und um die Kurven
driften. In den Galerien fühle ich mich nämlich rasch alleine. Die Gemälde
ziehen wenige Besucher an. Und von den Aufsehern werden wir ganz genau beäugt.
Klar, ich habe das lange genug selbst gemacht, ich weiß, zu
Versicherungszwecken abgestellt, sehnt man sich nach menschlicher Gesellschaft
und Ablenkung. Juliane nimmt das weniger locker, sie fühlt sich wie ein
Ausstellungsobjekt oder die Dame mit Bart im Zirkus. Im Peabody Museum, dem Naturkundehaus,
trafen wir zahlreiche Eltern mit ihren Kindern.
Juliane und ich haben uns vor
allem auf den Saal über die Native
American Cultures gefreut. Wie ein Omen waren die Vitrinen leer, mit
Backpapier verklebt. Der Staub, erklärten die ausgehängten Texte, setzte den
Objekten zu, und die Schau müsse modernisiert werden. Das war enttäuschend. Da
halfen auch die Saurierskelette in der großen Halle nicht drüber weg. Die
Mineraliensäle sind Wahnsinn. Ich habe noch nie so große und perfekt
ausgestrahlte Kristalle und Steinformationen gesehen. Ein paar sehen aus wie aus
quietschbunten Plastik und vom Szenenbilder der Originalserie Raumschiff Enterprise entworfen.
Im Shop
am Ende der Tour durchs Haus waren meine Finger weiß und taub, und Juliane
klapperten die Zähne vor Kälte. Die Klimaanlage probte die nächste Eiszeit,
während im Kassenbereich die Heizkörper auf Hochtouren strahlten. Geht das hier
so weiter, unter diesem Präsidenten, dann können wir uns bald die letzte
Vitrine im Saal der menschlichen Evolution einrichten. Falls es den Bereich
dann noch geben sollte, und sich bis dahin niemand ein Beispiel an der Bildungspolitik von Ankara genommen
hat.
Fortsetzung folgt...