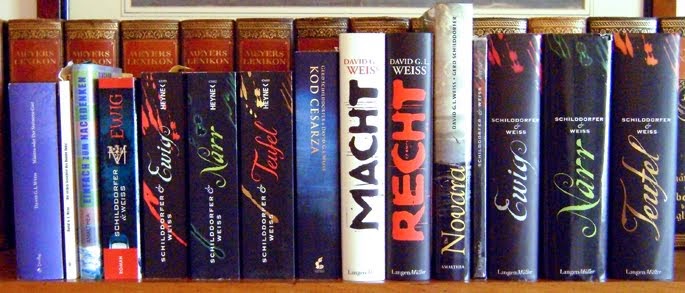Teil 17: Down in Dixie
Ich weiß wirklich nicht, warum
Juliane und ich nicht einmal einfach irgendwo hinfahren können, ohne dass uns
dabei die seltsamsten Dinge widerfahren. Diesmal habe ich die Gattin auf die GSA
nach Atlanta, Georgia begleitet, und es war wieder einmal so weit. Inzwischen
frage ich mich wirklich, welcher alte Chinese mich „zu einem interessanten
Leben“ verflucht hat. Eigentlich bin ich ihr oder ihm dankbar. Was wusste ich
bisher denn schon über Atlanta? Dass es im Bürgerkrieg komplett abgebrannt ist,
und dass Coca Cola von da stammt.
Losgegangen ist es in aller
Herrgottsfrühe am Tag unserer Abreise. Normalerweise kamen die bestellten Taxis
verlässlich eine halbe Stunde zu spät. Nein, als der Morgen graute, und die
Vögel in den Bäumen husteten, kam das Flughafentaxi zwanzig Minuten zu früh.
Netterweise kündigte man sich per Textnachricht an, und wir waren beide schon
gekämmt und bekleidet. Trotzdem erfolgte unser Aufbruch zum Hartford Bradley Airport (aka Hartford Springfield, ohne Spaß) etwas
überstürzt, aber nicht kopflos. Es wäre auch niemandem geholfen gewesen, hätten
wir ein Gepäckstück vergessen. Im schlimmsten Fall den Vortrag (Na Servus!). Oder ich wäre die Treppe
auf die Frontveranda hinuntergekugelt. Nichts davon ist geschehen. Dafür
anderes, aber davon wussten wir noch nichts.
Ich bin zum ersten Mal mit einem MacDonnell Douglas-Flugzeug geflogen,
jedenfalls bewusst. Es war ein kurzer und entspannter Inlandsflug von
zweieinhalb Stunden, von Wien aus wären wir wohl schon mindestens in Spanien
gewesen. Gemessen an den Kolleginnen und anderen Konferenzteilnehmern, die
Juliane am Gate getroffen hat, hätte man an einen Charterflug zur GSA denken
können. Und mit der eher kleinen Maschine waren wir alle nicht nur dabei,
sondern auch mittendrin im physikalischen Geschehen. Mir hat das ja gefallen,
aber Juliane wurde beim Starten und Landen ein klein wenig blass um die Nase. Sie
bevorzugt die wuchtigen Transatlantikflieger. Mehr Power! Ich bin dafür immer
wieder überrascht, welche Überseekoffer manche Leutchen als Handgepäck
mitführen. Die praktische Einbauküche im Rollkoffer, oder was? Wie dem auch
sei, Ankunft in Atlanta. Alles planmäßig, und das Wetter erwartungsgemäß sonnig
und heiter. Für meine europäischen Begriffe, sommerlich. 26 bis 28 Grad Celsius.
Und unglaublich feucht. O ja, das war er, der Süden der USA, wie ich ihn aus
meinen Jugendträumen kannte. Rein optisch hatte Atlanta, Georgia nichts mehr
mit dem Klischee gemein. Atlanta ist der Heimathafen von Delta Airlines, und Atlanta ist wie schon im neunzehnten Jahrhundert
ein Dreh- und Angelpunkt des Verkehrs. Wie die Narbe eines Rades, von dem die
Speichen in alle Richtungen abgehen. Früher waren es die Eisenbahnlinien, heute
sind es die Flugrouten. Den Eisenbahnknotenpunkt hatten General Sherman und die
Unionsarmee abgefackelt, aber der heutige Flughafen ist gigantisch. Hartsfield–Jackson
Atlanta International Airport hat zwei Terminals (Inland und International), sieben
Abflughallen und beschäftigt rund 70.000 Menschen. Um zum Gepäckband zu
gelangen, mussten wir einen Zug nehmen. Zum Glück wurde ich im Rollstuhl gefahren.
Andernfalls würde ich dort wahrscheinlich immer noch herumirren.
Von dem Atlanta meiner Träume war
nichts mehr übrig. Ich wusste, dass es in Rauch aufgegangen war. Die Stadt, die
uns empfing, hatte nichts mehr mit dem historischen Zentrum zu tun. Vom Highway
landeten wir direkt in Downtown an. Im Schatten der für die US-amerikanischen
Innenstädte typischen Hotelschluchten. Wir waren nur eine Parallelstraße vom
eigentlichen Stadtzentrum entfernt, unser Motel
6 lag auf derselben Straße wie das Hilton,
das Marriott und das Sheraton, wo die GSA stattfand, aber es
fühlte sich wieder einmal nicht so an. Die ersten vom Straßenniveau einsehbaren
Stockwerke der benachbarten Häuser waren allesamt Parkgaragen. Der Asphalt der
Gehsteige war beulig und brüchig. Pionierpflanzen sprießten aus Sprüngen und
Fundamenten. Zwischen den öffentlichen Kunstwerken schliefen die Obdachlosen.
Oder sie irrten zwischen den Hotels, den Parkplätzen und Autovermietungen
herum. Die Anrainer scherten sich so wenig um sie, dass sie nicht einmal
vertrieben wurden. Da telefonierte ein Yuppie vor dem Hilton, keine zwei Meter daneben vertickten fragwürdige Gestalten
noch weit fragwürdigere Substanzen. Und ein aufpolierter SUV reihte sich an den
nächsten in der Auffahrt zum Valet-Parking.
Eine gewaltige Laufbahn auf Stelzen verband die Parkgarage mit dem Peachtree Center in der Parallelstraße,
um jeden ungewollten Kontakt mit dem öffentlichen Raum zu vermeiden. Und daran schloss
sich eine weitere Beobachtung an: Ich weiß, Uber
ist cool. Aber die meisten, vor allem Weiße, benutzen den spottbilligen
Fahrtendienst, um den öffentlichen Nahverkehr zu vermeiden. Öffentliche
Verkehrsmittel sind für Farbige und Latinos. Für diejenigen, die die schöne
Welt mit Aircondition am Laufen halten. Genau wie vor 150 Jahren.
Nachdem sich Juliane im Sheraton
für die GSA registriert hatte, sind wir ins Hard
Rock Café gegangen. Das war schon eine feine Sache, zwischen all den
Reliquien internationaler Musikgrößen seinen Cheeseburger und ein Bier zu
genießen. Und ich habe gelernt, dass die Hard
Rock Cafés inzwischen den US-amerikanischen Natives gehören, nämlich dem Seminole Tribe of Florida. Nach dem
Essen gingen Juliane und ich getrennte Wege. Juliane hatte ihren ersten Termin.
Tatsächlich sind in Downtown Atlanta vergleichsweise viele Menschen zu Fuß
unterwegs. Das verleiht der Stadt ein sicheres Gefühl. Aber sobald die
Passanten verebben, machte sich in mir ein seltsames Aufpassen breit. Eine
Alarmbereitschaft, die ich vom nächtlichen Nachhause Gehen in Wien Favoriten
nur allzu gut kenne. Als Behinderter am Stock wäre ich auch leichte Beute. Und
wirklich, als ich alleine ins Motel gegangen bin, hat mich auch schon einer von
den homeless people angequatscht. Ich
wollte mich nicht wie ein Arschloch aufführen, aber der benahm sich genau wie
aus dem Lehrbuch des kriminalpolizeilichen Dienstes: Überfreundlich, und er
wollte gleich Händeschütteln und Umarmen. Nein, mein Freund, das zieht bei mir
nicht. Zum Glück war ich nur ein paar Schritte vom Grundstück unseres Motels
entfernt. Es mag brutal klingen, aber wenn man Menschen zwingt, unter solch
menschenunwürdigen Umständen zu leben, verhalten sie sich eben irgendwann wie
Raubtiere.
Während Juliane und ich dann im
Bett in unserem Motelzimmer lagen, fiel die Aircondition aus. Und nicht nur
die, das ganze Haus war ohne Strom. Ein Auto war in den Pfosten mit der Strom-
und Telefonleitung gekracht. Ich hörte die Telefonate des Rezeptionisten mit
aufgeregten Hotelgästen und den Stadtwerken. Der Strom konnte in ein paar
Stunden wiederhergestellt werden, aber das WLAN war für ein bis zwei Tage beim
Teufel. Auf dem Parkplatz vor dem Motel gingen die Lichter in den abgestellten
Autos an. Juliane war nicht die einzige GSA-Teilnehmerin im Haus. Und viele
mussten noch ihre Texte für die Arbeitsgruppen überarbeiten oder lesen.
Am nächsten Tag die freudige
Nachricht: Der dritte Hurrikan in kürzester Zeit machte sich bereit, auf das
Festland der USA zu treffen. Nate
steuerte direkt auf Atlanta zu. Aber es war eh völlig wurscht, wo Juliane und
ich gerade waren, würde Nate nämlich seinen Kurs halten, traf er auch Boston. Nates
eintreffen wurde von CNN auf Sonntagnachmittag vorhergesagt. Und die mussten es
wissen, die haben ihre Zentrale in Atlanta. Und sie hatten völlig Recht. Sonntagnachmittags
war Nate bei uns. Als Tropensturm und absolut mieser Laune. Es hat geschüttet,
die Wolken hingen tief und es war stockdunkel draußen. Juliane musste durch
knöcheltiefes Wasser ins Sheraton auf die Konferenz und wieder zurück. Am Abend
in der Lobby reihten sich Essenslieferant an Essenslieferant, weil niemand von
den Gästen das Haus verlassen wollte. Die armen Zusteller. Aber die Pizza
schmeckte mir großartig. Überhaupt war Atlanta kulinarisch der Bringer. Abends
zuvor aßen wir mit einem Freund im Ponce
City Market, und abends zuvor mit einer Kollegin von Juliane im Trader Vic´s, einem coolen
hawaiianischen Restaurant, das es immerhin seit 42 Jahren gibt.
Nate hatte uns einen ganzen Tag Sightseeing
gekostet. Aber weil wir beim Flugbuchen am
und pm verwechselt hatten, ging unser
Flug nachhause nicht mittags, sondern quasi mitten in der Nacht. Was uns erst
geärgert hatte, war jetzt ein Glück. Ich wollte zwei Dinge in Atlanta unbedingt
sehen: Das Martin Luther King Memorial
und das Margret Mitchell House. Für
mich heute die zwei Seiten einer Münze, nämlich des alten Südens. Es hat zwar
immer noch geregnet. Und das Besucherzentrum im Martin Luther King Memorial hatte geschlossen, so dass Juliane
unser Gepäck mitschleppen musste. Das war ärgerlich und für sie sehr
anstrengend, weil wir uns natürlich die Ebenezer Baptist Church, das
historische Feuerwehrhaus und das Haus der Kings ansehen wollten. Wir haben
alle drei geschafft. Für mich etwas irritierend, weil mensch liebt ja das
Klischee: Das Martin Luther King Memorial gehört zu den Nationalparks. Ergo
dessen sind die Mehrheit der Angestellten Ranger. Und Weiße, noch dazu in
Uniform. Das kam ordentlich schräg bei mir an. Was mich geärgert und Juliane
gekränkt hat war, das einige der schwarzen Angestellten unglaublich
unfreundlich zu Juliane gewesen sind. Und immer nur dann, wenn ich nicht in der
Nähe gewesen bin. War es, weil sie weiß und blond war und mit deutschem Akzent
sprach? Ich weiß es nicht. Denkbar wäre es. Mich hat auf der Suche nach einem
Restaurant, um die Wartezeit bis zur Führung im Geburtshaus zu überbrücken, ein
Obdachloser gefragt, ob er mir seine „Bälle“ zeigen soll. Nein, danke, das Angebot
habe ich höflich ignoriert. Die Gegend rund um die historischen Stätten sah
überhaupt aus, dass wir uns zunächst gefragt haben, wo zum Teufel sind wir da
bloß gelandet? Die Graffitis internationaler Street Art-Größen (unter anderem der
gebürtige Steirer Nychos) an den Feuerwänden verrieten aber, dass das Viertel
hipp sein musste. Auch die überaus netten vollbärtigen und tätowierten Jungs,
die uns unseren Lunch machten und servierten, sprachen dafür. Ich komme mit den
sozialen Widersprüchen in diesem Land nur schwer klar.
Die Führung im Geburtshaus hat
ein blinder weißer Ranger gemacht. Und seine Performance war in jeder Hinsicht
bemerkenswert. Zum einen hat er mit schauspielerischer Grandezza jedem Mitglied
der Familie King eine eigene Stimme gegeben und damit dem Ort Leben
eingehaucht, zum anderen hat er es geschafft, den Spirit der Bewegung zu
vermitteln und Äußerlichkeiten und Unterschiede vergessen zu machen. Auf jeden
Fall für den Moment, und hoffentlich auch langfristiger.
Im Martin Luther King Memorial
habe ich zum ersten Mal die Worte von Martin Luther King junior (1929-1968) wirklich
vernommen. Ich habe selten so eine Kraft und Klarheit gespürt. Ich habe schon
Biographien von Menschen gehört, die überzeugte Atheisten geworden sind, weil
sie als Jugendliche eine schlechte Predigt von einem (alten) Trottel gehört
haben. Hier, in der Ebenezer Baptist Church, hat ein Mann gepredigt, der mit
seinem Mut die USA verändert hat. Und mit seinen Worten aus Mitläufern
Bürgerrechtler gemacht hat.
Und um das Kontrastprogramm voll
zu machen, im Margaret Mitchell House geleitete uns eine souveräne und
gebildete alte Afroamerikanerin durch das Leben und das Apartment der Autorin
von „Vom Winde verweht“. Nach dem bürgerlichen Haus der Kings und vor allem nach
der Villa Mark Twains war ich überrascht, dass die Autorin des Megabestsellers
und Filmklassikers mit ihrem zweiten Mann in einem Zweizimmerapartment gewohnt
hat. Die Wohnung hatte etwas von einem Wiener Gemeindebau in den
Zwanzigerjahren. Überhaupt stimmte es mich bedenklich, wie vielfältig Menschen
in ihren Ansichten sein können. Margaret Mitchell (1900-1949) war eine
überzeugte Feministin, brach mit gesellschaftlichen Konventionen, arbeitete als
Reporterin, war einmal geschieden und trat vehement für das Stimmrecht von
Frauen ein. Aber sie wollte den Raum nicht mit Afroamerikanern teilen.
Obwohl Clark Gable dagegen
protestiert hatte, durften die schwarzen Darsteller nicht an der Filmpremiere
von „Gone with the Wind“ in Atlanta
teilnehmen. Man befürchtete Unruhen. Das war 1939. Der Darsteller des Ashley
Wilkes, Leslie Howard, war auch nicht dabei, er wurde 1943 von der deutschen
Luftwaffe abgeschossen.
Ich habe die großmütterliche Dame,
die uns geführt hat, auf den Rassismus in „Vom Winde verweht“ angesprochen.
Ihre Antwort war beeindruckend. Margret Mitchell war in einem Umfeld
aufgewachsen, in dem der alte Süden noch am Leben war, und der Bürgerkrieg das
tägliche Gesprächsthema in der Familie. Mitchell erfuhr überhaupt erst viel
später, dass die Konföderation den Krieg verloren hatte. Sie lebte und schrieb
über ihre Kultur, und das war der historische Süden. Für diese klare Analyse
verdiente die alte Dame meinen Respekt. Martin Luther King angewandt. Ich kann
das Verhalten Margaret Mitchells dank ihr nachempfinden. Das Trauma des
Kriegsendes wurde in meiner Familie auch an die späteren Generationen weitergegeben.
An mich jedenfalls. Ich habe zuerst Heimatverlust und Opferrolle gelernt, die historische
Täterschaft musste ich mir erst erarbeiten. Und das Runterbeten von Fakten im
Geschichtsunterricht war dabei eher kontraproduktiv. Das zeigt sich ja leider
auch in den aktuellen Wahlergebnissen.
Obwohl das Wetter nach wie vor
bescheiden war, wurde unser Heimflug nicht vom Winde verweht.
Diejenigen, die
panisch ihren Heimflug vorverlegt hatten, hatten da oft weniger Glück. Bei uns
lief alles glatt. Naja, bis auf die Tatsache, dass unser Koffer in Hartford
nicht auf dem Gepäckband erschien. Das stimmte meine müde Gattin ein wenig
ungeschmeidig. Indes, das gute Stück hatte einen Flug vorher genommen und
wartete schon längst vor dem Büro des Special Service auf uns. Das wusste
wiederum der nette junge, natürlich hispanische Mann, der meinen Rollstuhl
schob.
Nach diesem erfrischenden
Zwischenspiel ging es rasch über den nächtlichen Highway nachhause. Nate war
auch schon da, die Wolken hingen tief und es war heiß und feucht. Trotzdem: Seltsam,
wie schnell man sich zuhause fühlt. Ich spürte ein sehr warmes und vertrautes
Gefühl, als ich die Hügel, die Bäume und die Orte Neuenglands vor dem
Seitenfenster vorbeiziehen sah. Schaute ganz anders als das flache Georgia aus.
In der Küche dann die große Überraschung: Wir hatten bei unserer eiligen
Abreise vergessen, die Milch zurück in den Kühlschrank zu stellen. Eine ganze
Gallone war grün geworden. Die sich breitmachende Pilzkultur schien kurz davor
zu stehen, eine Schrift zu entwickeln. Aber der Müdigkeit gedankt, es war uns
völlig wurscht, und wir sind ins Bett gefallen.
Fortsetzung folgt…