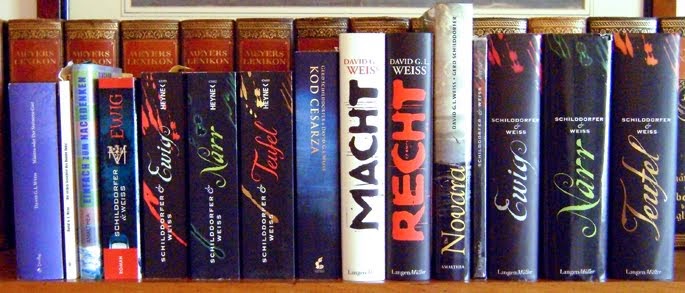Teil 20: Fest- und Feiertags- Saison, New York
Ein Aufatmen der Erleichterung
geht durch die USA. Gefolgt von einem Rülpser. Thanksgiving ist vorbei! Der
Festtagsschmaus ist überstanden, der Braten aufgegessen und verdaut. Der
freundliche Gummitruthahn zum Aufblasen ist von der benachbarten Frontveranda verschwunden.
Der mannsgroße Indian in Pilgerkleidung hat bereits Santa Claus Platz gemacht.
Indian, so hieß der amerikanische Vogel früher einmal in Österreich. In
Erinnerung an den größten Verfranzer der Weltgeschichte. Vorsicht Kalauer: Ein
Italiener am Steuer halt. Und heute gibt´s alles Gute von der Pute. (Haha!)
Jedenfalls im Magen ist wieder Platz für Kekse und allerhand andere
Feiertagsspezereien, die verschlungen werden wollen. Aber eines nach dem
anderem…
Unser erstes Thanksgiving haben
Juliane und ich beim Institutsvorstand und seiner Frau verbracht, im Kreis der
internationalen Gäste des German Departments. Das war ein sehr nettes und
warmherziges Aufsammeln der Internationalen, da Thanksgiving als das wichtigste
säkulare Familienfest betrachtet wird. Für einige ist es inzwischen wichtiger
geworden als das leider doch recht kommerzialisierte und dank einigen Fundis
überfrachtete und explosive Weihnachten. Das äußerte sich im Alltag. Die Woche
vor Thanksgiving gestaltete sich ordentlich stressig, da alles Dringende vorab und
alle Vorbereitungen dafür erledigt werden musste. Das heißt: Bevor dieses Jahr
von Donnerstag bis Montag gar nichts mehr ging, und alles öffentliche Leben
pausierte, was in den USA höchst ungewöhnlich ist. Es gibt keine religiösen
Feiertage, und z.B. die Post kommt auch sonntags. Selbst die Yale-Shuttles
stellten ihren Betrieb ein. Die Wohnungen und Häuser ringsum standen leer, die
meisten waren woanders zuhause oder bei jemandem zu Gast. Dieser Umstand
bereitete uns große Freude, als am Mittwochabend ein Feuermelder zu quäken
begann. Es war beruhigend zu erleben, dass sich bis Sonntagabend kein Mensch um
den Alarm kümmerte. Verglichen mit dem anhaltenden Technikterror durch diese
offensichtlich nutzlosen, dafür aber unsäglich lauten und nervtötenden Geräte,
wäre es mir schon fast lieber gewesen, es hätte tatsächlich nebenan gebrannt.
Da wäre nach dem „Brand aus!“, Ruhe gewesen. So waren wir dazu verdammt,
abzuwarten, bis sich endlich herausstellte, in welchem der verlassenen
Apartments ringsum das verdammte Ding piepte und/oder warum. Einer unserer eigenen
Brandmelder, der in der Küche (!), war jedes Mal losgegangen, nachdem ich ein
putziges kleines Brathühnchen (eine Cornish Hen) beim Zubereiten mit Wasser
übergossen hatte. Dampf stieg auf, Deckenterrorist quäkte. Die Auflösung der
Ursache der Thanksgiving-Lärmbelästigung ergab dagegen eine ebenso
erschütternde wie lächerliche Pointe.
Die Tage vor und um Thanksgiving
waren schon immer als reichlich gefährlich verschrien. Zu dieser besonderen
Zeit im Jahr sollten Spaziergänger die Wälder Neuenglands besser meiden. Der Ruf
der Natur war und ist im Indian Summer am lautesten. Manch einer spürt dann seine
gottgegebene Berufung zum Jäger. Können und Talent, den Feiertagsbraten selbst
zu erlegen, so denkt der Nachfahre der Pilgerväter, sei ihm in die Wiege gelegt.
Dass dieselben Vorfahren ohne die Natives hilflos verhungert wären, deren Fest
sie da schamlos als das ihre begehen, darüber wird der Mantel des Vergessens
gebreitet. Die Traditionellsten jener Herrschaften sind übrigens oft die, deren
Urgroßväter erst in die USA kamen und die heute einen Einwanderungsstopp für
Wirtschaftsmigranten fordern. Ich will ja keine Namen nennen. – Steve Bannon! –
Aber egal! Wer dem Herumballern entflieht, der meidet auch besser die
Hausmannskost und das Selbstgebackene. Denn wie es die eine oder einen nur
einmal zum Jagen in den Wald verschlägt, verschlägt es die oder den anderen nur
dieses eine Mal im Jahr zum Essenmachen in die Küche. Trotzdem ist es ein
ungeschriebenes Gesetz und eine unbedingt zu erfüllende Erwartung etwas
eigenhändig Zubereitetes zum Thanksgivingschmaus mitzubringen. In unserem Fall
war die geschlechtsspezifische Rollenverteilung klar. Wie es Gott gewollt hat!
Meine Frau hat den Fusel eingekauft, ich hab Kürbissuppe gekocht. Und nachdem
ihre Flaschen und mein Topf (der größte, den ich habe) relativ flott leer waren,
haben wir unseren Teil des Jobs gut erledigt.
Überhaupt war es ein sehr schöner
und geselliger Abend. Das vom Gastgeberpaar bereitete Hauptgericht samt
Beilagen schmeckte fantastisch. Die von den Gästen mitgebrachten Zu- und
Nachspeisen waren auch gut und allesamt bestens durchdacht, trotzdem
stellenweise halbgar. Ganz nach scholastischer Tradition. Wir trafen uns schon
nachmittags, wie es üblich ist, zu Drinks und Konversation im Wohnzimmer und zu
Zigaretten auf der hinteren Veranda. Ein inzwischen befreundeter Brite hatte
vor vier Jahren mit dem Rauchen aufgehört, wegen der supersportlichen und
sittenstrengen Amerikaner hat er in Yale wieder damit angefangen. Ich denke, das
mit dem relativ frühen Treffpunkt vor dem gemeinsamen Abendessen wird gemacht,
dass man bis zum Essen schon soweit beduselt ist, dass einem innerfamiliäre bzw.
zwischenmenschliche Spannungen, Schrotkugeln im trockenen Truthahn und
klebriger Kekse-Teig völlig wurscht sind. Bei mir hat es geklappt. Ich habe
Thanksgiving sehr genossen. Juliane fühlte sich danach ein wenig voll. Vom
Essen, nicht vom Trinken!
Sonntagabend kamen dann auch
unsere Nachbarn endlich nachhause. Vom Fenster aus beobachteten Juliane und ich
eine aufgeregte Expedition mehrerer Pärchen zu einer Mulde, abgestellt auf dem Parkplatz
hinter den Nachbarhäusern. In einem der Gebäude wird scheinbar renoviert, und jede
Menge Baumaterial in dem Container entsorgt. Nach längerem Waten und Wühlen im
Dreck war der Übeltäter endlich gefunden. Das Piepen des Rauchmelders
verstummte. Irgendjemand hatte die Brandmelder mitsamt der Batterien und
funktionstüchtig in die Mulde geworfen. Auf die Idee die giftigen Dinger vor
dem Entsorgen aus den Geräten zu nehmen, ist niemand gekommen. Hätten wir nicht
schon unter einem Völlegefühl gelitten, uns wäre schlecht geworden.
Am 30.11. war Thanksgiving dann
auch schon verdaut. Und der Appetit auf Advent in New York geweckt. Der Plan
war so simpel wie genial: Mit dem Commuter-Train, dem Pendlerzug, an den Big
Apple und dort ins Cafe Sabarsky in der Neuen Galerie an der Park Avenue. Das
Sabarsky war bzw. ist ein original Wiener Kaffeehaus wie es selbst in Wien nur
noch wenige gibt. Es teilt sich das Dach mit der „Goldenen Adele“, kaum
restituiert schon hierher verkauft, und liegt nicht zufällig in der Nachbarschaft
der deutschsprachigen jüdischen Gemeinde. Kurz gesagt, ich war voller
Erwartung. Die (deutschsprachige) Speisekarte verhieß einen Tag in Alt-Wiener
Tradition vom kleinen Gulasch bis zum Einspänner. Entsprechend gutgelaunt
fuhren wir zur Unionstation. Wir haben es halt einmal probiert und gefragt, ob
ich mit meinem österreichischen Behindertenpass eine Fahrpreisermäßigung auf
das Ticket nach New York bekomme. Anstandslos! Der Schalterbeamte hat bloß kurz
erstaunt geguckt. Ein Behindertenausweis mit Foto und im Scheckkartenformat,
das war ihm neu. Die US-Amerikanischen Verkehrsbetriebe gaben mir also wider
allen Erwartungen und entgegen aller Klischees Rabatt wegen meines
Gesundheitszustands. Anders als die Wiener Linien, die mir trotz Zusatzeintrag „Fahrpreisermäßigung“
auf meinem Behindertenpass keine geben, weil ja niemand anderer bzw. keine
soziale Einrichtung ihren dadurch entstehenden Verdienstentgang ersetzt. Meine
Jahreskarte habe ich darum diesen Monat nach 21 Jahren gekündigt. Im Pendelzug
von Connecticut nach New York hätte sie mir eh nichts genützt, weder ermäßigt
noch weiterhin zum Vollpreis.
Der Blick aus den Fenstern
während der zwei Stunden Fahrt war bezeichnend und informativ. An der Küste
zwischen New York und Connecticut liegen die teuersten Anwesen der USA. Trotzdem
sahen einige Bahndämme aus wie Müllkippen, und manch ein Bach- oder kleiner
Flusslauf auf seinem Weg zur Küste ähnelte einem Gewässer in einem Slum. Juliane
meinte, dass es interessant sei, von der Eisenbahn die Rückseite dieser Welt betrachten
zu können. Ich hoffe sie hat Recht, und der Ausblick war „bloß“ die Rückseite
der Verhältnisse dieser Gesellschaft und nicht ihre Vorderansicht. Ohne
zunächst erkennbarer Logik wechselten sich gepflegte Ortschaften mit obskuren Siedlungsformen
ab. Einfamilienhäuser, Golfplätze und weiße Kirchen mit besprühten Werkhallen,
baufälligen Hütten und Halden aus abgewrackten Hochseebooten. Dann wurde klar,
je näher wir New York kamen, desto einkommensstärker und urbaner wurden Umfeld
und Infrastruktur. Sogar die Bronx wirkte im Vergleich zu einigen Dörfern entlang
des Weges „zivilisiert“ und am Leben.
Die Central Station war für das
Weihnachtsfest festlich, farbenfroh und durchaus patriotisch geschmückt.
Weihnachtskränze in Rot und Grün, Stars
and Stripes in Blau-Weiß-Rot und Army-Soldaten und Nationalgardisten in
Camouflage und Feldbraun. In der Vanderbilt Hall besuchten wir die größte
überdachte Holiday Fair der USA. Das war sehr nett. Aber die Klischees über New
York müssen ja auch irgendwoher kommen. Wir hatten einen Christkindlmarkt
erwartet, gefunden hatten wir einen hochpreisigen Designermarkt mit etwas
Christbaumschmuck und Flitter. Trotzdem schön zum Anschauen. Wir haben uns auch
zwei Christbaumstücke geleistet. Einen Engel und einen Bären. Natürlich
handgefilzt aus Kirgistan. Muss ja.
Mit der U-Bahn in die 86th
Street. Von da zu Fuß weiter, es wartete der Verlängerte zur Belohnung. Und
wirklich, wir wurden freundlich empfangen. Ein netter Mann im Anzug hielt uns
die Tür auf, bat uns herein. Dann machten wir den Fehler und fragten nach dem
Kaffeehaus. Heute geschlossen, wegen einer privaten Veranstaltung! Die
Enttäuschung stand uns ins Gesicht geschrieben. Die Chance hatten wir vertan,
uns in den Event zu schummeln. Wir mussten gehen. Die Gattin nahm es gelassen
und in ihrer ganz eigenen Professionalität. Nur zwei Hauserblöcke weiter ärgerte
sie sich bloß noch in Zimmerlautstärke. Meine Stimmung war auch nicht die
beste. Zwei Stunden Zugfahrt für Arsch und Friedrich! Was soll´s, sagte ich,
gehen wir halt was essen. Und wirklich, keinen Steinwurf entfernt die
Gelegenheit: Ein kleines französisches Restaurant mit für die USA und vor allem
New York moderaten Preisen. Jeweils ein zweigängiges Menü (Prix fix inklusive
Glas Wein) später, ging es uns beiden besser. Ich verspeiste ein typisch
französisches Gericht: Ein Steak mit Pommes frites, serviert mit einer Flasche
Heinz Ketchup. Mon Dieu, es gibt sie wirklich, die zweite Sozialisation! Juliane
aß eine köstliche Ente à l´ Orange, die allerdings zu ihrer Überraschung weder
nach Ente, noch nach Orange schmeckte. Weil sie zum Hauptgang ein Coq au vin
bestellt hatte. Lost in translation. Wie dem auch sei, ich nahm zum Abschluss
ein Glas Chartreuse. Dabei löste ich mit meiner Aufforderung, mir mit den
Eiswürfeln vom Leib zu bleiben, Verwirrung und Entsetzen aus. Weil dieser
Kräuterlikör scheinbar höchst selten, und wenn, in NY immer mit Eis bestellt
wurde, hatte der Kellner keine Ahnung, wie viel davon er mir in welches Glas
einschenken sollte. Die Chefin übernahm selbst. Und ich bekam nach mehreren
Versuchen mit falschen Gläsern, einen halbvollen Kognakschwenker. Das war reichlich
zum Preis eines Shots. Zuletzt doch noch Glück gehabt!
Eigentlich wollte ich mir noch
den Christbaum vor dem Rockefeller-Building ansehen, aber der Chartreuse und
meine Beine hatten andere Pläne. Juliane entschied, die Rückreise anzutreten.
Auf dem Weg zur U-Bahn kamen wir an der New Yorker Version des legendären Witte
an der Linken Wienzeile vorbei. Dasselbe Geschäftsmodell, dasselbe Aussehen,
das war wohl kein Zufall bedenkt man, in welcher Gegend wir waren. Ein vor
Weihnachtsschmuck, Partyzubehör, Scherzartikeln und Spielwaren blendend
strahlender Laden bot ich unseren staunenden Blicken. In der Auslage das Beste
beider Welten: Chanukka und Weihnachten friedlich vereint. Blau, Rot und
Flitter bis zur Reizüberflutung. In dem Geschäft gab es alles, vom aufblasbaren
Herrnhuter Stern Made in China bis zu Schokoladen-Makkabäern hergestellt in Brooklyn.
Servietten, Deko, Christbaumstücke, alles entweder mit Stern und Quaderschrift
in Weiß und Blau, oder christlich-weihnachtlich in Gold, Grün und Rot. Sogar
goldene Buddhas mit pastellfarbigem Flitter für Adventkranz und Christbaum
fanden sich im Sortiment. Das Resultat war ein veritabler Weihnachtsflash samt
Kaufrausch. Sowas kommt von sowas, unser Heim strahlt jetzt US-adventlich. Im
Wohnzimmer hängt ein goldener Herrnhuter Stern-Ballon mit einem Meter
Durchmesser. Der geriet mir beim Zusammenbauen etwas größer, als ich erwartet
hatte. Der „kleine“ rote am Fenster misst bloß 70 Zentimeter. Etwas für die
Nachbarn: Roter Stern New Haven! Und wenn einer sensiblen Seele jetzt etwas oder
jemand im friedlichen und multikulturellen Miteinander abgeht, keine Angst. Die
allgegenwärtigen freundlichen Wachsoldaten mit der Waffe im Anschlag erinnerten
uns in der Central Station und an jeder Holiday Fair daran, wer oder was für Europäer
inzwischen in dem Bild fehlt. Die Eingänge zu den Weihnachtsmärkten sahen aus
wie die Einfahrten von Militärcamps. God bless America! Und die gelungene
Integration!
Der Pendlerzug zurück nach New
Haven war in wenigen Minuten voll. Es gab keinen freien Sitzplatz mehr. Zum
Glück waren wir etwas früher auf dem Bahnsteig gewesen. Dabei fuhren die
Garnituren alle zwanzig Minuten. Und weil dem so ist, wird das Angebot bestens
genutzt. Der Zug ist dadurch bequemer und schneller als das Auto. Die einzelnen
Stationen der Rückreise hörten sich als Durchsage für mich in etwa so an: „This
Port, Next Port, Another Port, Further Port, New Haven!“ Ich wollte ja
schließlich an der Küste leben. Da darf ich mich nicht wundern, wenn die Orte
alle Port hießen, Hafen.
Fortsetzung folgt…
 |
| Die Unionstation in New Haven, CT. |