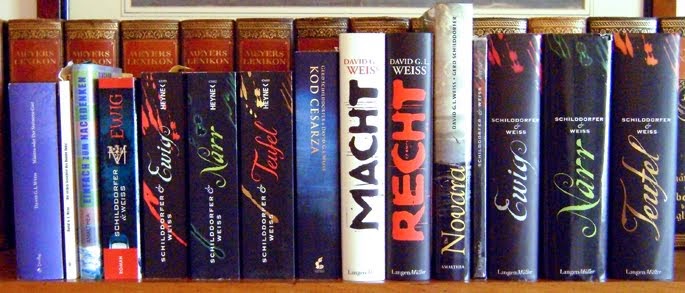Teil 28: From New Haven to L.A. – Narzisstenbeet und Wallfahrtsort
Bis zu diesem Blogbeitrag hat es
eine Weile gedauert. Darum geriet er etwas länger.
Im Leben eines chronisch Kranken
mit Behinderung geschieht nicht viel. Wobei, es passiert eine ganze Menge,
jedoch nichts, worüber sich für Leserinnen und Leser fesselnd berichten ließe.
Nach nunmehr einem Jahr in den USA ist der Alltag endlich wirklich zum Alltag
geworden. Es macht sich ein Gewöhnungseffekt und daraus resultierend, Routine
bemerkbar. Schritt für Schritt entwickeln wir uns zu einem Detail des Gesamtbilds.
Kein Halsrecken und Aufhorchen mehr, wenn Juliane oder ich einen Raum betreten.
Nur eines wird sich wie erwartet niemals ändern, sobald ich den Mund aufmache,
tönt Wien heraus. Meinen Herkunftsakzent können weder Vollbart noch Basecap
camouflieren. Gemeinsam mit der Muttersprache befinden sich auch andere,
unveränderliche Bauteile im und auf dem Motherboard des Europäers. Schreibgeschützte
Elemente im Betriebssystem gewissermaßen. Wenn es fünf Wochen in Anspruch
nimmt, um sein neues Medikament nach der Verschreibung durch den Rheumatologen
seines Vertrauens endlich in der Hand zu halten, dann führt das zwangsläufig zu
einer Aktennotiz. Nämlich bei der Schnittstelle zwischen dem US-amerikanischen Gesundheitssystem
und unserer deutschen Krankenversicherung. An diese Servicehotline wenden sich
alle Internationalen, die in den USA Medikamente beziehen müssen. Die Hotline
ist als Arbeitgeber sehr beliebt. Auch und vor allem bei unseren farbigen
Mitmenschen. Dieses Detail wäre mir im Grunde völlig egal, spielte diese
Facette nicht eine wesentliche Rolle in der Reaktion der Angestellten auf die Probleme
innerhalb der interkulturellen Verständigung. Eine lange Geschichte kurz
gemacht: Ein kranker Mensch will und braucht seine Medikamente. Dabei ist es
ihr oder ihm herzlich egal, welche Nation ihr Siegel auf ihren oder seinen Pass
gedrückt hat. Der durchschnittliche Hotline Mitarbeiter, kann er (oder sie)
sich keinen Reim auf das Gehörte machen, lässt das Anliegen einfach
unbearbeitet liegen. Rätsel knacken, das gehört nicht zum Job! Die
Gesprächspartner versprechen zurückzurufen und legen auf. Der internationale
Patient rechnet mit und wartet auf einen Anruf. Dummerchen! Das gegebene
Versprechen hat hierzulande dieselbe Güteklasse wie in Italien die Auskunft
eines Passanten, dass die gesuchte Touristenattraktion in der dritten Gasse
links ist. Beides ist frei erfunden. Eine Floskel, um die völlige Ahnungslosigkeit
zu verbergen, das Gesicht zu wahren und sich aus dem Spiel zu nehmen. Das gebiert
Misstrauen. Umso größer die Überraschung, befindet sich das Gesuchte
tatsächlich in der dritten Gasse links, oder falls eine Servicemitarbeiterin
tatsächlich zurückruft. Immerhin, das Letzte geschieht dann doch immer wieder.
Trotzdem, der Geduldsfaden eines kranken Menschen, oder wie in unserem Fall der
der besorgten Ehepartnerin, ist mürbe und rissig. Besonders, wenn das
Medikament lebenserhaltende Funktionen erfüllen sollte. Anders gesagt: Nicht in
den USA sozialisierte Bürger haben nie gelernt, Ärger und Frustration fortwährend
herunterzuschlucken. Und zwar so lange, bis eine oder einer mit versteinertem
Lächeln in einen Waffenladen geht und Amok läuft. Nein, Europäer werden
irgendwann ungemütlich, laut und fordernd. Dann erst kommt das Gegenüber
irgendwann darauf, dass die internationalen Krankenversicherer am
US-amerikanischen Codesystem nicht teilnehmen. Die Computersysteme sind
inkompatibel, Fragesteller und Befragter verstehen sich nicht. Weshalb das US-amerikanische
Programm bei jeder Anfrage an einen ausländischen Versicherer die Antwort
bekommt, dass die Krankenversicherung die Kosten für die Verschreibung oder
Behandlung nicht übernimmt. Und obwohl diese Meldung sachlich und inhaltlich nicht
stimmt, ist sie das Signal für den durchschnittlichen US-amerikanischen Jobholder,
alles liegen und stehen zu lassen. Und dieses Fallenlassen der Leinen, lässt
den kranken Ausländer oder seine Angehörigen die Stücke ausfahren und feuern. Nach
dieser folgerichtigen Entladung, konnte ich nach fünf Wochen das neu
verschriebene Medikament einnehmen. Obwohl der Arzt meine Reaktion auf die
Einnahme nach zwei Monaten überprüfen wollte. Egal. Ende gut, alles gut! Das
denkt man. Aber nein, lese ich mir dann die Bewertungen des Arbeitgebers
Servicestelle im Internet durch, erfahre ich in den entsprechenden Threads,
dass Europäer alles „hasserfüllte Menschen“ sind. Unbelehrbare Rassisten. Allen
voran die Schweden. Natürlich, Skandinavier sind ja überhaupt und überall als besonders
altbacken und verschlossen verschrien. Liegt wahrscheinlich daran, dass sie
alle blond und blauäugig sind… Wie dem auch sei. Die einfache Antwort auf ein
komplexes Problem ist eben aus allen Richtungen und Blickwinkeln schnell
gefunden.
Das hart erkämpfte Objekt meiner
Begierde löste in der darauffolgenden Woche die tollsten Nebeneffekte bei mir
aus. Die Details erspare ich gerne. Nur so viel: Ich habe in diesen wenigen
Tagen zwanzig Pfund, rund neun Kilogramm (20 lbs = 9,07 kg), abgenommen. Meine im
Vergleich zu früheren Kleidergrößen grotesk winzige 32-32 Jeans flattert am
Bund. Doch das Resultat ist trotzdem gut. Das Medikament tut, was es soll. Es
bewirkt eine medizinisch feststellbare Verbesserung.
Mit diesen wenigen Informationen
versorgt, kann sich jede und jeder leicht vorstellen, wie ich in diesen Tagen
auf mich selbst beschränkt gewesen bin. Die Existenz beginnt, sich auf den
Zustand zu konzentrieren. Die Gedanken kreisen stets um das eigene Ich. Ich
würde mich freuen, könnte ich für dieses fortgesetzte Um-sein-Selbst-Gravitieren
das Bild eines Sonnensystems verwenden. Vielgestaltige Welten, die um ein
strahlendes Zentrum rotieren. Aber leider fühlte ich mich mehr wie eine
Stubenfliege mit einer Schlinge aus Bindfaden um den Hals. Am gespannten Zwirn
brummte mein Verstand ständig um dieselben Fragen. Grübeln liefert niemals
Antworten. Gefangen in der Endlosschleife. Die diversen Fehlfunktionen meines Stoffwechsels
begrüßte ich als willkommene Abwechslung. Weil sie ein reales Problem
darstellten, kein eingebildetes.
Und noch ein weiterer Schimmer am
Horizont verkündete Hoffnung. Und das just zu Ostern. Ich begleitete Juliane
nach Kalifornien. Genauer gesagt an die ACLA an der UCLA in LA,CA. Was sich
hier liest wie ein Jandl-Gedicht bedeutet: Juliane organisierte und leitete ein
Panel auf dem Jahrestreffen der American
Comparative Literature Association an der University of California, Los Angeles in Los Angeles, California. Kalifornien!
Das klang wie das Land der Verheißung. Wo es sich lebt wie im Schlaraffenland,
immer warm, mit blauem Himmel und unter Palmen. Unnötig zu sagen, dass wenn wir
dort hinflogen, alles anders kam. Wenn ich den Chinesen erwische, der mich
verflucht hat, indem er mir ein interessantes Leben gewünscht hat!
 |
| Die Rocky Mountains. |
 |
| Der Grand Canyon. |
Der Mann, der mich in Los Angeles
in Empfang nahm hatte (natürlich) dieselbe Heritage wie sein Kollege in Connecticut,
er war jedoch überaus freundlich. Kalifornien begrüßte mich vorbehaltslos mit
einem Lächeln. Und der blaue Himmel und die wirklich bis an den zehnten Stock
hinauf reichenden Palmen ließen das Wintergrau Neuenglands rasch verblassen.
 |
| Hübsch, aber leider... |
Nachdem Juliane nur Gutes über
diese Unterkunftsform gehört hatte, buchte sie uns erstmals ein Apartment über
die Internetplattform. Es sollte unsre erste und letzte Buchung damit werden.
James, so hieß der Vermieter in seinen Emails, sagte uns schriftlich zu, dass
wir bereits um 11 in seine Wohnung könnten. Er selbst würde nicht da sein, der
Schlüssel aber unter der Fußmatte. Soweit so gut. Das Haus lag in einer
wunderbaren Gegend. Bei dem benachbarten prachtvollen Art Deco-Gebäude handelte
es sich nicht wie erst angenommen um eine Kirche oder Synagoge, sondern um ein
Kino. Das passte hervorragend ins Klischee. Ins Klischee passte leider auch,
dass die Schlüssel zum Apartment nirgends zu finden waren. Nach rund sieben
Stunden Flug hinter sich und einer Konferenzeröffnung vor sich, war das keine
Freude. Unser James hatte uns zwei Telefonnummern gegeben. Die Büronummer war
abgemeldet, die Mailbox der Handynummer voll. Die Ansage verriet, dass er im
Moment wohl Nachhilfe im Surfen, Racen oder Golfen brauchte und darum nicht
erreichbar war. All das erwies sich nicht als vertrauensfördernde Maßnahme. Zum
Glück war Julianes Gastprofessor mit demselben Flug angekommen. Ihn riefen wir
an, und er besorgte uns auf Anhieb ein Zimmer in seinem Hotel. Nicht bloß das
letzte verfügbare Hotelzimmer, nein, das behindertengerechte Zimmer des Hotels.
Wer kann es ihm verdenken, dass er für einen kurzen (und berechtigten) Moment
Allmachtgefühle verspürte. Wann und wo wären sie angemessener als unter solchen
Umständen in Kalifornien. Ich war beruhigt, denn ich hatte schon befürchtet,
dass er sich langsam wie ein Pfleger einer Irrenanstalt mit uns als Patienten fühlen
musste.
Auf dem Weg in unser „Most Western Best Western“ machten wir
mit dem Autoverkehr in Los Angeles erste Bekanntschaft. Die Fahrt von einem
Stadtviertel ins gegenüberliegende am anderen Ende der Stadt konnte aufgrund
des immensen Verkehrsaufkommens und der Staus mehrere Stunden dauern. In
anderen Bundesstaaten entsprachen diese Reisezeiten der Fahrt in eine
Nachbarstadt. Unterwegs wurde mir auch klar, weshalb derart riesige
Straßenkreuzer beliebt waren. Ein europäischer Kleinwagen konnte unter
Umständen in den hiesigen Schlaglöchern verloren gehen. Die Highways und Straßen
waren riesig, bis zu acht Fahrstreifen, ihr Zustand war weniger begeisternd.
Die Begeisterung über die Palmen am Straßenrand, die Sonne und die netten
Uber-Fahrer überblendeten diese Schattenseiten hervorragend. Auch die riesigen
Fahnen, die an den Baukränen im Wind flatterten. Mit einem solchen Ungetüm
könnte ich leicht unser ganzes Haus in New Haven verhüllen.
Während der Uber-Fahrt ins Hotel
rief unser Vermieter an. Plötzlich hieß er Michael. Und nach wenigen
gewechselten Worten brüllte er Juliane an. Check-In wäre immer erst ab 5 Uhr
nachmittags. Trotzdem verlangte er jetzt, es war 12:30, eine Entscheidung, ob
wir kämen oder nicht. Juliane lehnte unverzüglich ab. Bei jemanden, der uns
ohne jeder Affektkontrolle anschreit, wollten wir nicht übernachten. Zum Glück
hatten wir alle seine Emails aufgehoben. James oder Michael, er hatte uns in
die Irre geführt, der Schlüssel lag nicht um 11Uhr für uns bereit. Außerdem
hatte er uns nicht informiert, welche gesundheitsschädlichen Baustoffe in dem
Apartmentgebäude verarbeitet waren wie es dem Bundesgesetz entsprach. Gewisse
Baustoffe sind für Vermieter aushänge- und meldepflichtig. Den entsprechenden
Aushang am Gebäude haben wir fotografiert und an Airbnb weitergeleitet. Nachdem
er meine Frau angebrüllt hat, dass er eine strikte Kein Geld zurück-Politik hat, lernt er – James, Michael oder wie immer
er wirklich heißt – jetzt meine strikte Don´t
fuck with me-Politik kennen.
Aber egal. Das Hotel war ohnedies
die bessere Wahl. Hier gab es sogar öffentliche Verkehrsmittel ins
Stadtzentrum, eine Metrostation und einige Buslinien. Auch der
Universitätscampus war ein Augenöffner. Olivenbäume, rote Koniferen und Palmen
entlang der Fußwege und Fahrbahnen. Dicke, überreife Zitrusfrüchte an den
Bäumen. Zwischen den wunderbaren Pflanzen historische und zeitgenössische
Universitätsgebäude. Die Architektur ein faszinierender Stilmix. Sämtliche
Epochen von der Antike bis zur Gegenwart unter dem gemeinsamen Nenner
Jugendstil vereint. Und über allem wehten natürlich Stars and Stripes und der Bär der Republik von Kalifornien. An
diesem Ort befanden sich Patriotismus und Infrastruktur auch in Harmonie.
 |
| Nancy und Blanchot... Auweia! |
 |
| Trump und Kim haben es lustig... |

 Kleine possierliche Pelztiere, die
mich an Ziesel mit kurzen buschigen Schwänzen erinnerten. Leider lebten sie im
und vom Dreck. Wie allerorts üblich warfen viele Leute ihren Abfall überall
hin. Der zweite Blick auf die elegante Gartenlandschaft enthüllte die
Pappbecher, Plastiksackerl und Papierbeutel. Auf die Essensreste der
Wegwerfgesellschaft stürzten sich die kleinen Nager mit Begeisterung. Sie
huschten herbei und wickelten mit schnellen Pfoten alles Essbare aus, um mit
vollen Backen im Dickicht und den zahlreichen Erdlöchern in der steilen Uferböschung
zu verschwinden. Diese unterirdischen Bauten begünstigten wohl auch die
gefürchteten Mudslides/Erdrutsche, deren Narben entlang der Promenade gut sichtbar waren. Auf den Wiesen und unter den mächtigen Stämmen lebten auch einige Obdachlose unter denselben Bedingungen wie die Ground-Squirrels. Die zahllosen Spaziergänger nahmen von ihnen keinerlei Notiz. Das ist ein weiterer, schwieriger Aspekt des Lebens in den USA, mit dem Elend seiner Mitmenschen geht man um, indem man es ignoriert.
Kleine possierliche Pelztiere, die
mich an Ziesel mit kurzen buschigen Schwänzen erinnerten. Leider lebten sie im
und vom Dreck. Wie allerorts üblich warfen viele Leute ihren Abfall überall
hin. Der zweite Blick auf die elegante Gartenlandschaft enthüllte die
Pappbecher, Plastiksackerl und Papierbeutel. Auf die Essensreste der
Wegwerfgesellschaft stürzten sich die kleinen Nager mit Begeisterung. Sie
huschten herbei und wickelten mit schnellen Pfoten alles Essbare aus, um mit
vollen Backen im Dickicht und den zahlreichen Erdlöchern in der steilen Uferböschung
zu verschwinden. Diese unterirdischen Bauten begünstigten wohl auch die
gefürchteten Mudslides/Erdrutsche, deren Narben entlang der Promenade gut sichtbar waren. Auf den Wiesen und unter den mächtigen Stämmen lebten auch einige Obdachlose unter denselben Bedingungen wie die Ground-Squirrels. Die zahllosen Spaziergänger nahmen von ihnen keinerlei Notiz. Das ist ein weiterer, schwieriger Aspekt des Lebens in den USA, mit dem Elend seiner Mitmenschen geht man um, indem man es ignoriert.
Für Ostersonntag hatten wir uns
den Höhepunkt unseres Aufenthaltes aufgehoben: Die Warner Bros. Studio Tour. Wir fuhren also mit dem Uber über den wie
gewöhnlich verstopften Highway hinüber nach Burbank, vorbei an gruseligen
Brandnarben und ausgebrannten Wohnhäusern direkt neben der Autobahn. Da bekamen
wir erst ein Gefühl dafür, wie nahe die Buschfeuer der Millionenstadt gekommen
waren. Und den luxuriösen Anwesen, die wie mittelalterliche Burgen oder
bronzezeitliche Fürstensitze auf den Hügeln ringsum thronten. Am Ziel unserer
Fahrt wurde mir schnell eines klar: Ich bin in meinem Leben schon an einigen
Wallfahrtsorten gewesen. Auch an den bedeutendsten. Nach Santiago de Compostela
war ich sogar zu Fuß gepilgert. Ich traue mich also zu sagen, dass ich einen
Kultplatz erkenne, an dem Heilige und Reliquien verehrt werden. Und Plätzen
gehuldigt wird, an denen sich Ereignisse einer Heilserzählung oder eines Mythos
ereignet haben (sollen). Das Warner Bros.-Gelände war so ein Ort. Und ich
wollte und konnte mich seinem Zauber nicht entziehen. An die Stelle der traditionellen
spirituellen Erfahrung durch Selbsterfahrung war der Spaß getreten. Eines
hatten klassische und dieser sehr gegenwärtige Wallfahrtsort gemeinsam, den
Parafernalien-Laden am Ende der Reise. Hier Merchandising und Shop genannt. Das
Geldausgeben am Ende komplettierte hier wie dort den Rausch. Juliane und ich
können jederzeit und überall gut auf Geldausgeben verzichten, aber mindestens
ich schwebte auch ohne Shopping-Flash die meiste Zeit auf Wolke Sieben.
 Nach einem kurzen Einführungsfilm
in einem Kinosaal, fuhren wir in einem mehrreihigen Besucherwagen ins Gelände.
Das ganze Firmengelände war auf das Drehen von Filmen ausgelegt. Die Gründer,
die vier Warner-Brüder, die allerdings ganz anders hießen, verlangten, dass
jedes Gebäude als Drehort verwertet werden konnte. Dadurch sieht die
rückwärtige Fassade eines Verwaltungsgebäudes auch zum Beispiel wie ein Motel
aus. Zimmertüren inklusive. Allen Kunden war alles erlaubt und offen. Unter einer Bedingung: You’ve got the Dime, we‘ve got the time!
(Du hast das Geld, wir haben die Zeit!) Bei den Warner Brothers gibt es
buchstäblich die legendären Potemkin’schen Dörfer zu entdecken. Jedes Haus ist
bloße Fassade. Nach jeder Seite stellt es ein anderes Gebäude dar. Es
erstrecken sich ganze Straßenzüge von New York in die eine Himmelsrichtung, in
die andere ist es San Francisco. Und in der Mitte eine Kleinstadt des Mittleren
Westens der USA, die liebevoll „Überall in Amerika“ genannt wird. Mit Kirche,
Bank, High School und Universität. Und jedes davon nur wenige Meter tief.
Anschein ohne Inhalt. Auch ohne Gehalt, die Wände und Mauern sind aus
Fieberglas.
Nach einem kurzen Einführungsfilm
in einem Kinosaal, fuhren wir in einem mehrreihigen Besucherwagen ins Gelände.
Das ganze Firmengelände war auf das Drehen von Filmen ausgelegt. Die Gründer,
die vier Warner-Brüder, die allerdings ganz anders hießen, verlangten, dass
jedes Gebäude als Drehort verwertet werden konnte. Dadurch sieht die
rückwärtige Fassade eines Verwaltungsgebäudes auch zum Beispiel wie ein Motel
aus. Zimmertüren inklusive. Allen Kunden war alles erlaubt und offen. Unter einer Bedingung: You’ve got the Dime, we‘ve got the time!
(Du hast das Geld, wir haben die Zeit!) Bei den Warner Brothers gibt es
buchstäblich die legendären Potemkin’schen Dörfer zu entdecken. Jedes Haus ist
bloße Fassade. Nach jeder Seite stellt es ein anderes Gebäude dar. Es
erstrecken sich ganze Straßenzüge von New York in die eine Himmelsrichtung, in
die andere ist es San Francisco. Und in der Mitte eine Kleinstadt des Mittleren
Westens der USA, die liebevoll „Überall in Amerika“ genannt wird. Mit Kirche,
Bank, High School und Universität. Und jedes davon nur wenige Meter tief.
Anschein ohne Inhalt. Auch ohne Gehalt, die Wände und Mauern sind aus
Fieberglas. Es hat auch den Anschein, dass
die Tour regelmäßig den Bedürfnissen der Zeit angepasst wird. Das heißt, die
Ausstellungsstücke und Anekdoten stammen und umkreisen aktuelle Blockbuster und
TV-Produktionen. So stand auch ein Besuch der Sound Stage der bundesweit (und
wohl auch international) beliebten Talkshow „Ellen“ auf dem Programm. Das
Studio hat mich weniger aufgrund seines rituellen Wertes begeistert, aber mit
seiner schieren Größe beeindruckt. Ich habe ja schon Fernsehstudios mit
Beleuchtung und Requisite gesehen, aber noch keines, das eine großflächige Industriehalle
gefüllt hätte. Wobei auch die Klassiker nicht zu kurz kamen. Zu wissen, an dem
Ort zu stehen, an dem die klassischen Gangsterfilme mit James Cagney gedreht
wurden, oder Szenen meiner Lieblingsfilme, das löste Euphorie aus. Und ich bin
der Meinung, es ist dieselbe, die der Glauben hervorruft, in den Fußstapfen
einer oder eines Heiligen zu wandeln. Und wie gesagt, Teil der Studiotour sind
auch jede Menge Reliquien. Keine Körperteile, aber jede Menge so genannter
Berührungsreliquien. Ob es sich dabei um die Kutte des Heiligen Franziskus,
oder den Anzug von Humphrey Bogart oder die Rüstung von Wonder Woman handelt,
das ist Hemd wie Hose. Der Effekt und das zugrundeliegende Konzept ist meiner Erfahrung
nach dasselbe. Es erfüllt dieselbe kulturelle Funktion. Meine diesbezüglichen
Bedürfnisse wurden jedenfalls bestens gestillt. Ich durfte meinen Leinwandhelden,
den Diven (nomen est omen) und ihren getragenen
Kleidern und genutzten Gefährten huldigen sowie den von ihnen berührten
Versatzstücken. Und es war herrlich, so frei Mensch sein zu dürfen.
Es hat auch den Anschein, dass
die Tour regelmäßig den Bedürfnissen der Zeit angepasst wird. Das heißt, die
Ausstellungsstücke und Anekdoten stammen und umkreisen aktuelle Blockbuster und
TV-Produktionen. So stand auch ein Besuch der Sound Stage der bundesweit (und
wohl auch international) beliebten Talkshow „Ellen“ auf dem Programm. Das
Studio hat mich weniger aufgrund seines rituellen Wertes begeistert, aber mit
seiner schieren Größe beeindruckt. Ich habe ja schon Fernsehstudios mit
Beleuchtung und Requisite gesehen, aber noch keines, das eine großflächige Industriehalle
gefüllt hätte. Wobei auch die Klassiker nicht zu kurz kamen. Zu wissen, an dem
Ort zu stehen, an dem die klassischen Gangsterfilme mit James Cagney gedreht
wurden, oder Szenen meiner Lieblingsfilme, das löste Euphorie aus. Und ich bin
der Meinung, es ist dieselbe, die der Glauben hervorruft, in den Fußstapfen
einer oder eines Heiligen zu wandeln. Und wie gesagt, Teil der Studiotour sind
auch jede Menge Reliquien. Keine Körperteile, aber jede Menge so genannter
Berührungsreliquien. Ob es sich dabei um die Kutte des Heiligen Franziskus,
oder den Anzug von Humphrey Bogart oder die Rüstung von Wonder Woman handelt,
das ist Hemd wie Hose. Der Effekt und das zugrundeliegende Konzept ist meiner Erfahrung
nach dasselbe. Es erfüllt dieselbe kulturelle Funktion. Meine diesbezüglichen
Bedürfnisse wurden jedenfalls bestens gestillt. Ich durfte meinen Leinwandhelden,
den Diven (nomen est omen) und ihren getragenen
Kleidern und genutzten Gefährten huldigen sowie den von ihnen berührten
Versatzstücken. Und es war herrlich, so frei Mensch sein zu dürfen. Ein mit Augenzwinkern
vorgetragenes Ziel der Tour war es, den Glauben der Besucher in Film und
Fernsehen zu erschüttern. Nichts war in Wahrheit so, wie es dargestellt wurde.
Im vorletzten Teil der Tour zeichnete eine Ausstellung den Weg einer Film-
und/oder TV-Produktion bis zum fertigen Produkt nach. Es hat mich gefreut, die
Entwicklung einer Geschichte von der ersten Idee bis zum fertigen Produkt
realistisch dargestellt zu sehen. Von der ersten Skizze, über die viele
Versionen bis zum tatsächlichen Szenenablauf. Es ist vielleicht
desillusionierend, aber Geschichten schreibt nicht das Leben, Geschichten sind
harte Arbeit. Das Handwerk muss erlernt werden, und das Werkzeug hat sich seit
der Poetik des Aristoteles nicht
verändert. Bei Warner Brothers werden die Manuskripthalden gezeigt, die vielen Storyboards
und die vollen Mülleimer. Wenn ich als Autorin oder Autor spüre, dass sich
etwas niederlässt und mir ins Ohr flüstert, dann bin ich kein inspirierter
christlicher Heiliger mit der Taube des Heiligen Geistes auf der Schulter,
sondern dann ist es Zeit, meine Tabletten zu schlucken und mit einem
Therapeuten zu sprechen. Oder in meinem Fall mit dem Arzt über die Dosierung
meiner Medikamente. Warner Brothers setzten jedenfalls nicht auf
Bauernfängerei, sie erzählten keine sympathieheischenden Mythen über das
Manuskript. Übrigens inzwischen ein eigenes Forschungsfeld der
Literaturwissenschaft. Für mich war diese Offenheit ein Zeichen des Respekts
des Unternehmens vor seinen Kreativen und vor allem vor dem Publikum. Und wie
sich auch mit dieser Ausstellung beweisen lässt, ist die Wirklichkeit
faszinierender als jede erfundene Legende. Und wieder etwas, dass Religion,
Naturwissenschaft und dieser Ort gemeinsam haben.
Ein mit Augenzwinkern
vorgetragenes Ziel der Tour war es, den Glauben der Besucher in Film und
Fernsehen zu erschüttern. Nichts war in Wahrheit so, wie es dargestellt wurde.
Im vorletzten Teil der Tour zeichnete eine Ausstellung den Weg einer Film-
und/oder TV-Produktion bis zum fertigen Produkt nach. Es hat mich gefreut, die
Entwicklung einer Geschichte von der ersten Idee bis zum fertigen Produkt
realistisch dargestellt zu sehen. Von der ersten Skizze, über die viele
Versionen bis zum tatsächlichen Szenenablauf. Es ist vielleicht
desillusionierend, aber Geschichten schreibt nicht das Leben, Geschichten sind
harte Arbeit. Das Handwerk muss erlernt werden, und das Werkzeug hat sich seit
der Poetik des Aristoteles nicht
verändert. Bei Warner Brothers werden die Manuskripthalden gezeigt, die vielen Storyboards
und die vollen Mülleimer. Wenn ich als Autorin oder Autor spüre, dass sich
etwas niederlässt und mir ins Ohr flüstert, dann bin ich kein inspirierter
christlicher Heiliger mit der Taube des Heiligen Geistes auf der Schulter,
sondern dann ist es Zeit, meine Tabletten zu schlucken und mit einem
Therapeuten zu sprechen. Oder in meinem Fall mit dem Arzt über die Dosierung
meiner Medikamente. Warner Brothers setzten jedenfalls nicht auf
Bauernfängerei, sie erzählten keine sympathieheischenden Mythen über das
Manuskript. Übrigens inzwischen ein eigenes Forschungsfeld der
Literaturwissenschaft. Für mich war diese Offenheit ein Zeichen des Respekts
des Unternehmens vor seinen Kreativen und vor allem vor dem Publikum. Und wie
sich auch mit dieser Ausstellung beweisen lässt, ist die Wirklichkeit
faszinierender als jede erfundene Legende. Und wieder etwas, dass Religion,
Naturwissenschaft und dieser Ort gemeinsam haben.
Kalifornien. Ein Ort an dem Traum
und Wirklichkeit einander begegnen. Wo die Gefahr besteht, den Schein über das
Sein zu stellen. Aber auch die Chance, der Traumfabrik hinter die Kulissen zu
schauen und das Erschaffen und Gestalten mit wachen Augen zu erkennen. Los
Angeles war am Ende doch noch viel mehr für mich geworden als die Vorstellung
von Sonnenschein und Palmen.
Später am Abend ging es wieder
heim nach New Haven. Und die Ostküste und Connecticut empfingen uns nach sechs
Stunden Flug und mit höllisch schmerzendem Gesäß standesgemäß und stilecht zu
dieser Jahreszeit mit einem Schneesturm. Und da tauchte er natürlich gleich wieder
vor meinem geistigen Auge auf, der verklärte Sehnsuchtsort, der Himmel auf
Erden: Das immer sonnige und stets warme Kalifornien.